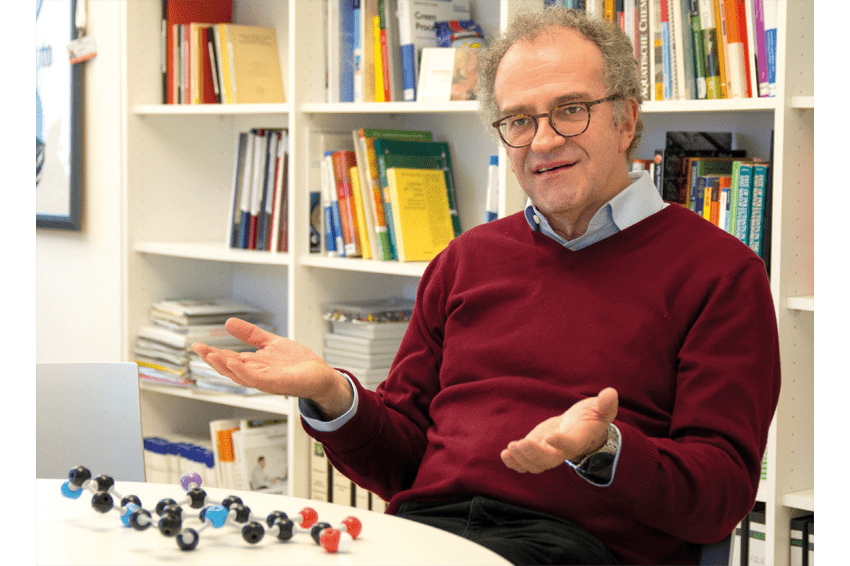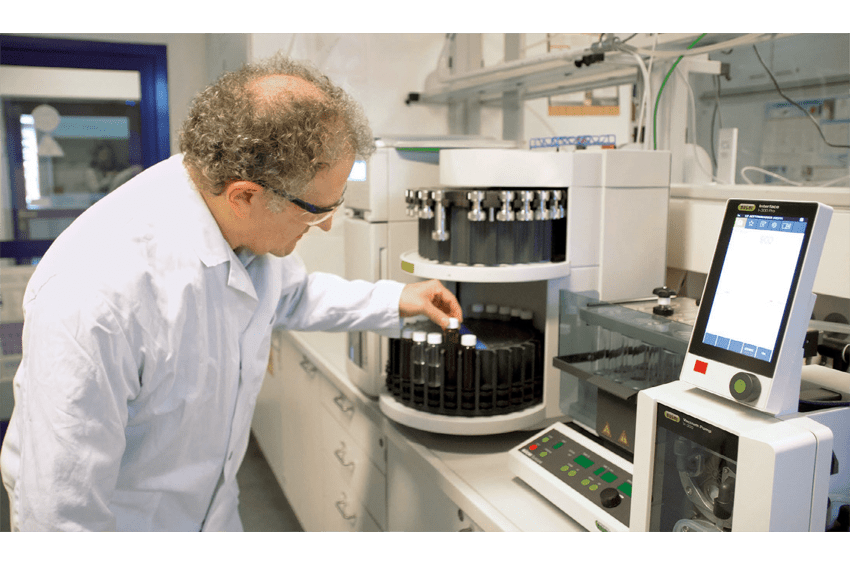Die Ziele nachhaltiger Chemie und die Grenzen der Kreislaufwirtschaft
Interview mit Klaus Kümmerer – Experte für nachhaltige Chemie und Träger des Wöhler-Preises
CITplus: Herr Kümmerer, wieso ist nachhaltige Chemie wichtig für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft?
Klaus Kümmerer: Nachhaltige Chemie sieht die Kreislaufwirtschaft in einem größeren Kontext. Sie stellt zuallererst die Frage, welche Funktion oder welchen Service wir haben. Nachhaltige Chemie betrachtet nicht nur einzelne Moleküle, Materialien oder Produkte, sondern die gesamten Stoff- und Materialströme. Darüber hinaus werden auch ethische, soziale und viele weitere Aspekte im Sinne des Systemdenkens betrachtet. Es wird auch gefragt, ob es eine nicht stoffliche Alternative gibt. Für eine funktionierende und langfristig erfolgreich zur Nachhaltigkeit beitragende Kreislaufwirtschaft müssen wir darüber hinaus Stoff-, Material- und Produktströme bezüglich der Vielfalt ihrer Zusammensetzung, ihrer räumlichen und zeitlichen Dynamik und ihrer Größe reduzieren.
Man denke zum Beispiel an die Vielfalt der Polymere, für die zusätzlich bis zu 10.000 Additive verwendet werden. Ein weiteres Beispiel sind Textilen, die meist mehrere Fasern gleichzeitig und dazu viele „Ausrüstungs“-Chemikalien enthalten. Wie wollen wir das erfolgreich recyclen!
Grundsätzlich benötigen globale, wachsende Kreisläufe auch mehr Energie, um diese am Laufen zu halten und woraus mehr stoffliche Verluste resultieren. Wenn das Recycling dem Tempo bei der Herstellung und Weiterentwicklung von Produkten nicht folgen kann, wird nicht recycelt werden.
Wir müssen den Gesamtzusammenhang sehen, sonst werden wir weiter das bekommen, was wir bereits als Ergebnis der vergangenen 200 Jahre haben: Die Stoff- und Materialströme werden immer größer und komplexer, die Ressourcen aufgebraucht, die Umwelt weiter verschmutzt. Auch für das Recycling wird Energie benötigt und es entstehen wiederum Abfälle, die, wenn überhaupt, nur mit großem Aufwand noch genutzt werden können, aber sicher nicht nochmals rezykliert werden können.
Welche Rolle spielt dabei Recycling?
K. Kümmerer: Recycling ist zweifellos ein wichtiger Baustein, aber eben nur einer von mehreren. Damit es gelingt, muss ich Stoffe, Materialien, aber auch Produkte von Beginn an so designen, damit sie bestmöglich zirkulieren und später recycelt werden können. Und wir müssen anerkennen, dass viele Produkte, die wir nutzen, gar nicht zirkuliert werden können, da sie unvermeidlich in die Umwelt gelangen. Diese müssen so designed sein, dass sie dort nach Erfüllung ihrer Funktion schnell und vollständig abbaubar sind! Bei anderen Produkten gibt es Abrieb, der dazu führt, dass ein Teil infolge der Nutzung unvermeidlich in die Umwelt gelangt. Auch das muss durch Design künftig mehrt berücksichtigt werden
Können Sie Beispiele nennen?
K. Kümmerer: Beispiele sind Arzneimittelwirk- und Hilfsstoffe, Tenside, Pestizide oder Bestandteile von Kosmetika, Farben und Beschichtungen von Oberflächen, Bestandteile, die von Produkten abgegeben werden wie zum Beispiel Additive aus Kunstoffen und viele mehr.
Ist Kreislaufwirtschaft denn ein Schlüssel zur Lösung der globalen Herausforderungen?
K. Kümmerer: Kreislaufwirtschaft ist auf jeden Fall ein Teil der Lösung. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass sie wie Recycling nicht zum Nulltarif zu haben ist, weder energetisch noch stofflich. Letztlich müssen wir uns eingestehen, dass es – und das sehen wir nur bei systemaren Betrachtungen – kein Upcycling gibt, sondern nur ein Downcycling und damit einhergehende unvermeidliche stoffliche und energetische Verluste. Wir werden am Ende immer etwas verlieren, Stichwort Entropie und Thermodynamik. Das können wir langfristig auch nicht mit immer mehr Energieeinsatz kompensieren, selbst wenn wir diese nachhaltig gewinnen, die ja wiederum auch Produkte zur Gewinnung benötigt, wobei Abfälle entstehen und so weiter. Was wir aber selbst entscheiden können ist, wie wir am wenigsten verlieren und es mit Blick auf die Zukunft jetzt am besten machen.
Welchen Beitrag leistet nachhaltige Chemie?
K. Kümmerer: Als konsequente Weiterentwicklung der grünen Chemie beschäftigt sich nachhaltige Chemie nicht nur damit, Energie und Abfälle einzusparen, Prozesse und individuelle Chemikalien weniger umweltschädlich zu gestalten und erneuerbare Ressourcen einzusetzen. Nachhaltige Chemie geht weit über diese sehr limitierte Betrachtung der Synthese und einzelner Syntheseprodukte hinaus. Es ist nicht automatisch alles nachhaltig, was eins oder gar alle der zwölf Kriterien der grünen Chemie erfüllt. Und es passt auch nicht automatisch alles in eine Circular Economy.
Wie sieht das in der Praxis aus?
K. Kümmerer: Nehmen wir die Fassade eines Hauses. Durch die Kunststoffe für Dämmung und Farben zum Schutz des Mauerwerks gelangen langfristig auch Stoffe und ihre oft unbekannten Produkte des unvollständigen Abbaus ins Grundwasser. Durch die niedrigere Außentemperatur infolge Wärmedämmung wachsen oft Algen oder Pilze auf der Fassade. Anstatt nun Biozide zu verwenden, die ebenfalls schon im Grundwasser nachweisbar sind, könnte man grüne oder graue Farbe verwenden, oder einfach die Verfärbungen akzeptieren. Biozid-freie Fassadenfarben gibt es als Reaktion auf unsere Forschung auch schon auf dem Markt, de facto weniger Inhaltsstoffe aber höherer Preis, da rechnet sich Nachhaltigkeit gleich zweimal. Die Beispiele zeigen, statt nun als erstes daran zu arbeiten, grünere Materialien zu entwickeln, richtet die nachhaltige Chemie den Blick darauf, welche Funktion diese denn erbringen sollen. Eine davon ist der verbesserte Schutz des Mauerwerks und das könnte man beispielsweise auch mit einem größeren Dachüberstand oder Holz, das natürlicherweise fungizide Inhaltstoffe enthält, erreichen oder einem klassischen mineralischen Putz. Oder man wohnt im Winter bei 18 oder 19 Grad und zieht einen Pullover an, dann braucht es weniger Dämmung, also weniger Material für die gleiche CO2-Einsparung.
Ein anderes Beispiel sind Zellulose oder Palmöl. Der Anbau auf kilometerlangen Plantagen in Malaysia benötigt Pestizide, Wasser und Flächen, die in Konkurrenz zur Nahrungsmittelerzeugung stehen. Nachhaltige Chemie betrachtet die Situation ganzheitlicher und somit auch die Auswirkungen auf Landwirtschaft und die Arbeitsbedingungen. Am Ende steht die Frage, was wir erreichen wollen und ob wir auf dem richtigen Weg sind anstatt einfach mit neuen Stoffen mehr oder weniger schlecht informiert loszustürmen. Wir brauchen mehr Service und Funktionen mit weniger Material und Energie, das ist das Ziel und die Herausforderung. Dieses Denken eröffnet neue Möglichkeiten.
Welche Kriterien wendet die nachhaltige Chemie darüber hinaus an?
K. Kümmerer: Es geht vor allem darum, stoffliche, soziale und ökonomische Rebound-Effekte zu vermeiden. Wir entwickeln etwas weiter, ohne zu bedenken, was wir damit langfristig auslösen können. Ein Beispiel sind die Seltenen Erden. Der Einsatz von weniger Material ist grundsätzlich gut und nachhaltig. Wenn das aber am Ende dazu führt, dass das Produkt günstiger wird und der Absatz steigt, mag das zwar aus betrieblicher Sicht und bezogen auf das einzelne Produkt effizienter und gegebenenfalls sogar nachhaltiger sein, mit Blick auf Ressourcenschonung ist aber nichts gewonnen, ganz im Gegenteil. Das Problem des Kunststoffrecyclings aus komplexen Produkten wie dem Auto tritt erst am Ende seiner Lebenszeit, also nach vielen Jahren und eventuell in einem anderen Land auf. Dasselbe gilt aus heutiger Sicht für den Einsatz der PFAS. In meiner Vorlesung kommen sie schon lange vor: Anfangs waren es sechs, dann 20, später 100, vor Kurzem habe ich noch von viereinhalbtausend Verbindungen gesprochen, heute sollen es bis zu 10.000 sein. Dabei wissen wir schon seit mehr als 20 Jahren, dass diese Ewigkeitsstoffe ein Problem sind. Und trotzdem will jeder Outdoorkleidung wie zum Bergsteigen tragen, auch wenn er nur zu Hause oder in der Stadt unterwegs ist. Wenn wir das Konzept der nachhaltigen Chemie schon gehabt hätten, wären die Probleme mit den PFAS in tausenden Produkten des täglichen Bedarfs dann genauso groß geworden?
Welche Rolle können und müssen Regierungen weltweit spielen?
K. Kümmerer: Wir brauchen ein klares Bekenntnis der Regierungen zu dieser neuen Art von Stoffwirtschaft mit weniger Vielfalt und weniger bewegter Masse. Wir sehen ja, was der Green Deal jetzt schon mobilisiert hat. Zum Beispiel die aktuelle Erprobungsphase des Ansatzes Safe and Sustainable by Design. Das ist ein sehr wichtiges Thema, zu dem aktuell sehr viel geforscht wird.
Die zentralen Fragen lauten: Wie kann man Design im Sinne einer Circular Economy und wie eine Non Toxic Environment Strategie umsetzen, also verhindern, dass giftige Verbindungen in Produkte und die Umwelt gelangen? Wir können natürlich das meist langfristig erfolglose, aber dafür für alle beteiligten teure Spiel von Verbot und Ersatz wie bisher weiterspielen und Ressourcen jeglicher Art damit verschwenden. Eine in vielerlei Hinsicht bessere Möglichkeit wären Positivlisten. Das schafft für alle beteiligten auf allen Ebenen Sicherheit, auch für die Industrie. Das wird etwas Zeit benötigen, aber wenn wir uns jetzt nicht auf den Weg machen, werden wir nie ankommen. Wie war es denn bisher? Wenn ein Stoff verboten werden soll, weil es sich als gefährlich herausstellt, dauert es oft sehr lange, weil viele Akteure mit unterschiedlichen Interessen beteiligt sind und es teilweise um viel Geld geht. Und dann kommt ein neuer Stoff auf den Markt, von dem Experten eigentlich alle schon wissen, dass er auch Probleme machen wird. Das Spiel geht von vorne los und es ist nichts gewonnen, gesamtgesellschaftlich schon gar nicht, aber auch für viele Unternehmen nicht. Insbesondere für die Downstream-User nicht, da wieder Produkte verändert und gegebenenfalls zugelassen werden müssen, was auch Zeit und Geld kostet. Flammschutzmittel sind dafür ein gutes Beispiel. Als Chemiker kann ich sagen, dass es auch intellektuell viel reizvoller ist, mit weniger verschiedenen Stoffen mehr zu machen.
Wie wichtig sind Initiativen wie das ISC3, um nachhaltige Chemie weltweit voranzutreiben?
K. Kümmerer: Sehr wichtig, mit dem International Sustainable Collaborative Center – ISC3 – setzen wir uns für die „Nachhaltige Chemie“ ein und erhoffen uns ein klares Bekenntnis der Regierungen auf der weltweiten Chemikalienkonferenz ICCM5 im September in Bonn. Es geht zum einen darum, das Verständnis für nachhaltige Chemie weiter zu verbreiten, zum anderen darum, die Akteure zu vernetzen. Und genau das sind zwei der Hauptziele des ISC3. Wir haben beispielsweise im ISC3 bereits vor knapp drei Jahren ein Positionspapier* erarbeitet, um das Konzept der „Nachhaltigen Chemie“ greifbarer zu machen. Denn das Interesse daran nimmt zu, bei jungen Menschen ebenso wie in der Industrie. Ich muss aber trotzdem sagen: wir stehen noch eher am Anfang.
Schauen wir auf Ihre Forschung, was begeistert Sie aktuell besonders?
K. Kümmerer: Das sind einerseits die alternativen Geschäftsmodelle, weil sie den Zusammenhang zwischen Bedürfnissen, der Ökonomie und nachhaltiger Chemie zeigen. Die alten Geschäftsmodelle sind angebotsgetrieben, Tonnage bezogen. Die Herangehensweise lautet: Hier ist ein Stoff, wofür kann er verwendet und möglichst viel verkauft werden? In den neuen Modellen geht es mehr Richtung nachfragegetrieben, Service und Wissen bezogen. Im Fokus stehen Antworten auf die Fragen: Was genau ist das Problem? Welche Services und Funktion werden benötigt? Und kann das auch durch eine andere Ausgestaltung zum Beispiel von Prozessen oder ganzen Anwendungsbereichen erreicht werden? Welche Rolle spielt Wissensvermittlung? Wie kann die Kommunikation unter allen Akteuren entlang des gesamten Produktlebenslaufs etabliert oder verbessert werden? Das erfordert ein radikales Umdenken, ein Systemdenken. Entsprechend haben wir dieses Denken in unserer, in Kooperation mit dem ISC3 entwickelten, akademischen Ausbildung an der Leuphana Universität integriert. In diesen weltweit einmaligen berufsbegleitenden Online-Studiengängen Master of Sustainable Chemistry und MBA Sustainable Chemistry Management lehren wir, die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt zu stellen, um echte nachhaltige Lösungen zu denken.
Als Chemiker weiß ich selbstverständlich, dass Chemie davon lebt, neue Produkte und Moleküle zu entwickeln. Wem das gelingt, der erntet Anerkennung im akademischen Bereich und der Industrie. Aber in Zukunft sollte es öfter darum gehen, wie man ein bestimmtes Molekül vermeiden kann oder für denselben Service weniger benötigt und trotzdem ans Ziel kommt. Genau das sollte belohnt und anerkennt werden und genau das machen wir zum Bestandteil des Studiums.
*Das Positionspaper des ISC3 zur „Nachhaltigen Chemie“ steht unter https://isc3.org/page/key-characteristics-of-sustainable-chemistry zum Download bereit